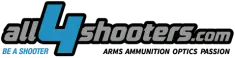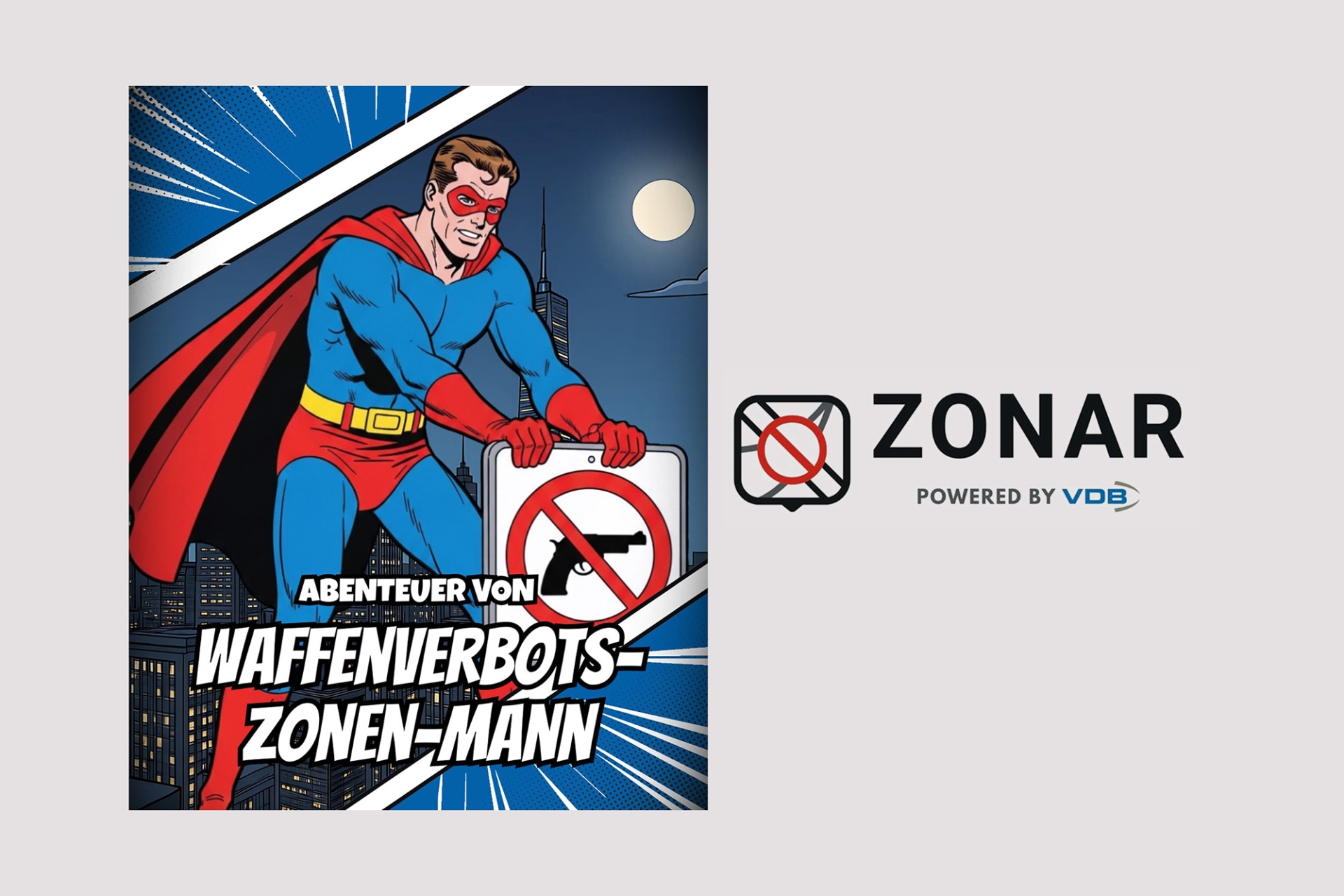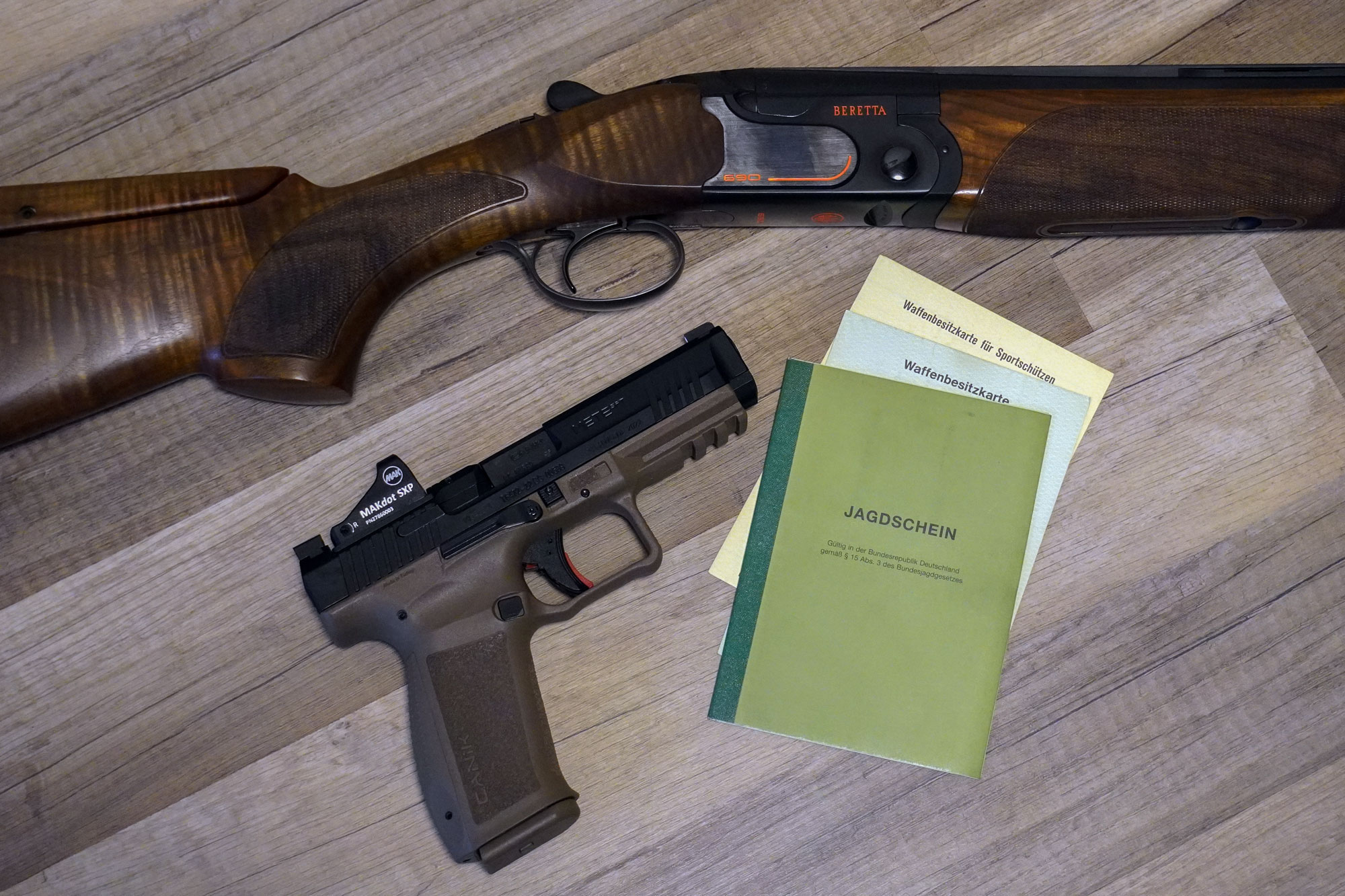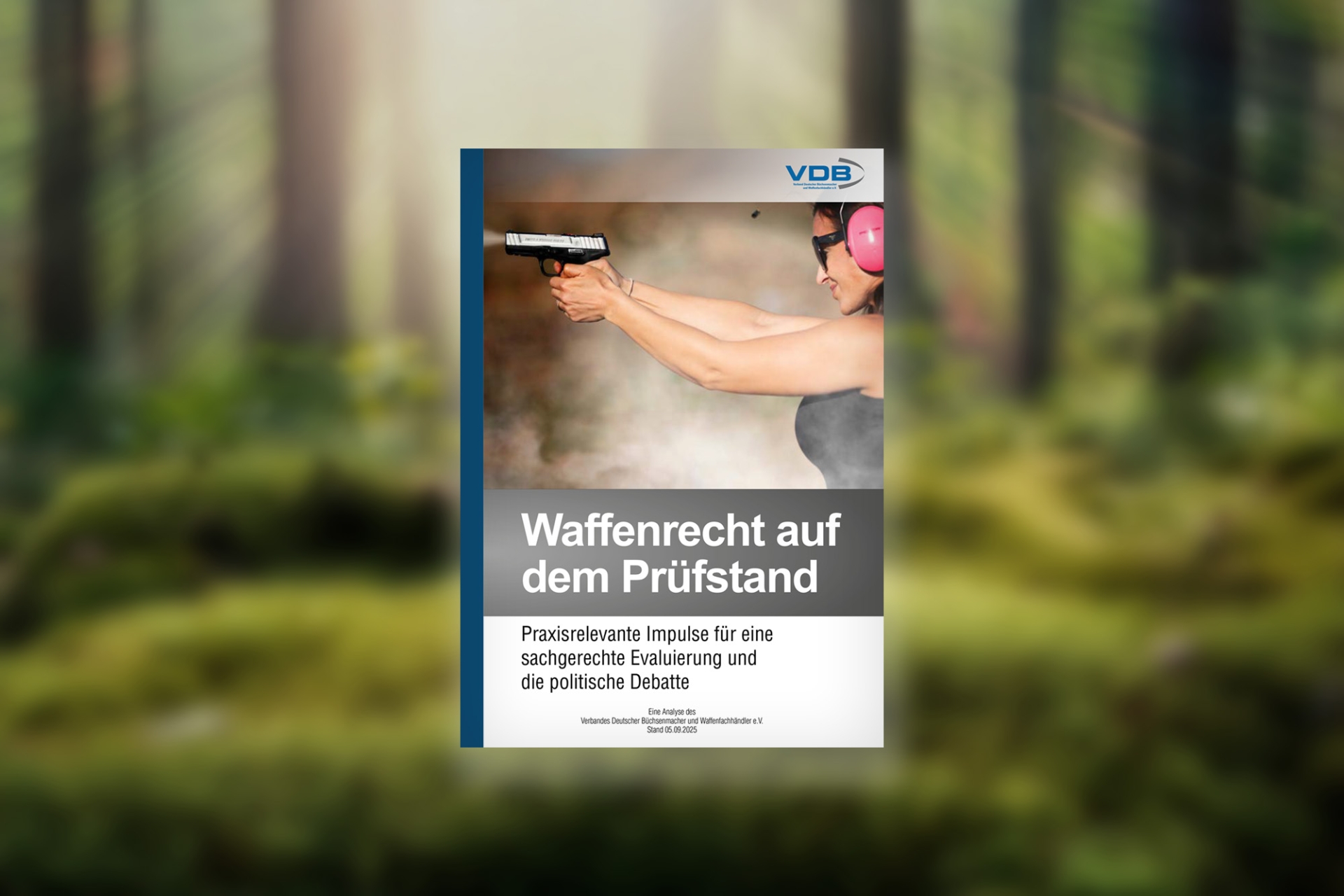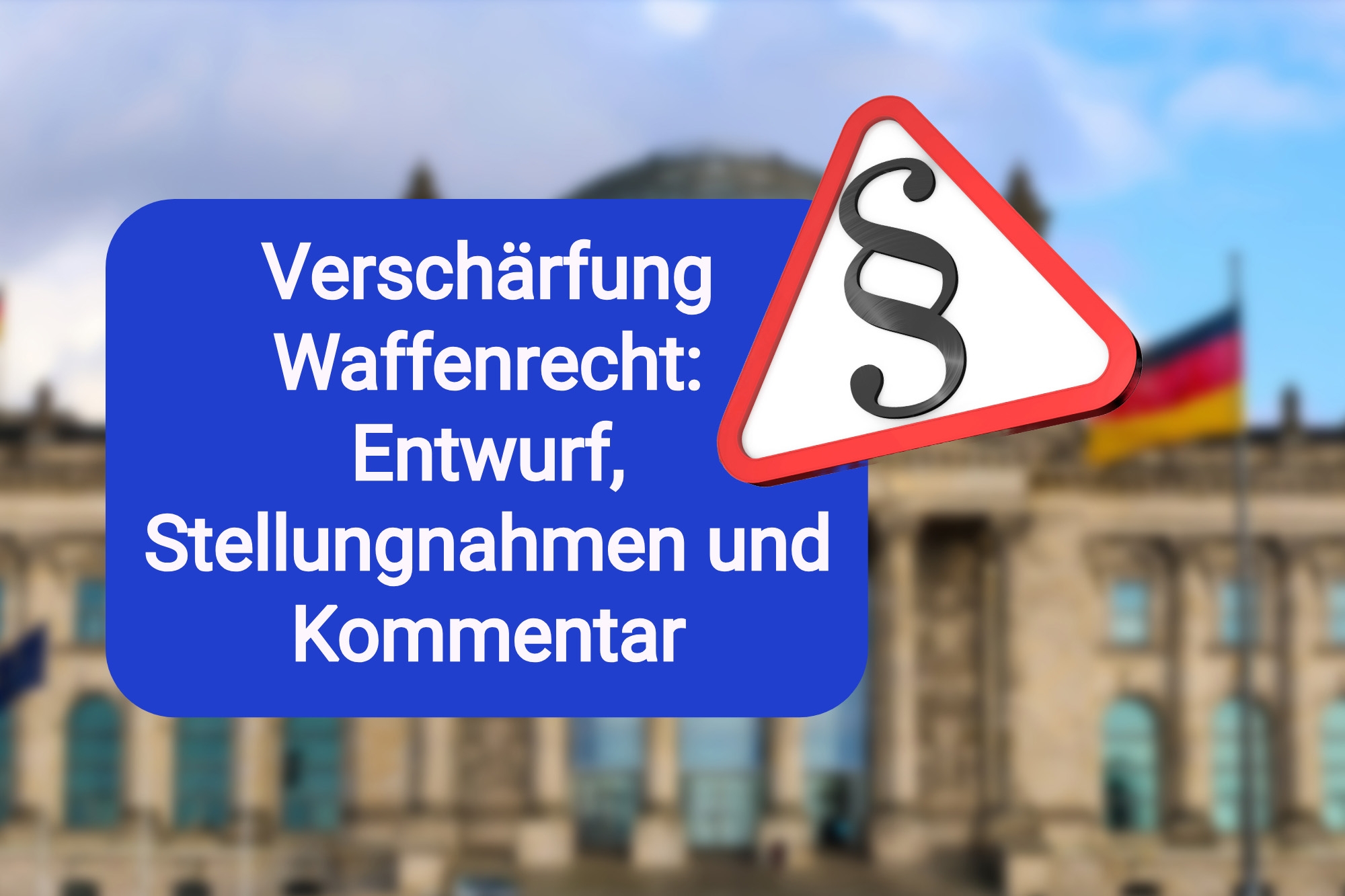Schreckschusswaffen sind ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Waffenkultur. Wahrscheinlich erfreuen sich die lärmerzeugenden Pistolen und Revolver hierzulande größerer Beliebtheit, als in jedem anderen Teil der Welt. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der Gesetzgebung: Während Schusswaffen und jede andere Form von Defensivmitteln in Deutschland größtenteils, verbotsähnlichen Einschränkungen unterworfen sind, konnten zumindest PTB-Waffen sich bisher eine maßvolle Regulierung erhalten. Anders gesagt: Deutschland ist eines der wenigen Länder der Welt, in denen es für Schreckschusswaffen einen Markt gibt. Andere Staaten regulieren entweder Schusswaffen deutlich weniger (USA) oder Schreckschusswaffen deutlich strenger (Italien). Mit diesem Umstand soll nach dem Willen des Hamburger Senats nun Schluss sein, denn der hat einen Entwurf zur Verschärfung des Umgangs mit Schreckschusswaffen in den Bundesrat eingebracht. Dazu hat auch der Innenausschuss Stellung genommen, und seine Empfehlung hat es in sich:
De facto Verbot von Schreckschusswaffen – das steht im Entwurf des Bundesrates
Die bisherigen Vorgänge nach ihrem zeitlichen Ablauf: Ursprünglich eingebracht wurde der Vorschlag zur stärkeren Regulierung von SRS-Waffen vom Bundesland Hamburg. Der Entwurf enthält im Wesentlichen den Vorschlag, dass bereits für den Erwerb einer Schreckschusswaffe der Kleine Waffenschein (KWS) vorgelegt werden muss. Er ist daher inhaltlich identisch zu den bereits aus dem Koalitionsvertrag der ehemaligen Ampelkoalition vereinbarten, aber nicht umgesetzten, Verschärfungen.

Viel weiter hingegen geht die im Zusammenhang mit dieser Initiative vom Innenausschuss des Bundesrates erarbeitete Beschlussempfehlung: Die sieht eine weitergehende Erlaubnispflicht für den Besitz von Schreckschusswaffen vor. Für den Kleinen Waffenschein wäre dann ein Bedürfnis und eine Sachkunde notwendig. Bereits erteilte KWS müssten abgegeben werden, ebenso wie die im Umlauf befindlichen, bisher vollkommen legalen Schreckschusswaffen. Dies wäre insbesondere eine Folge der Bedürfnispflicht, denn als Bedürfnis nennt die Beschlussempfehlung minutiös: Theateraufführungen, Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen, die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder Veranstaltungen der Brauchtumspflege, Bergsteiger, Inhaber eines Wasserfahrzeugs, Inhaber oder verantwortliche Person einer Vercharterung, Sportveranstalter oder verantwortliche Person einer Sportveranstaltung zur Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen bei Sportveranstaltungen oder Landwirte zum Vertreiben von Vögeln in landwirtschaftlichen Betrieben. Selbstverteidigung steht hier also explizit nicht. Was die Abgabe betrifft, ist keinerlei Entschädigung vorgesehen. Man behilft sich hier im Gesetz mit der üblichen Möglichkeit, die Waffen "einem Berechtigten" zu überlassen. Die wenigen Bürger, die noch ein Bedürfnis nachweisen könnten, müssten die Waffe analog zu Schusswaffen auch der zuständigen Behörde melden. Für den gesamten Vorgang sieht die Empfehlung des Innenausschusses eine Übergangszeit von vier Jahren vor.
Ein Hoffnungsschimmer liegt im Rechtsausschuss des Bundesrates. Der empfiehlt schon zum ursprünglichen Hamburg-Vorschlag, diesen nicht in den Deutschen Bundestag einzubringen. Die letztliche Entscheidung des Plenums des Bundesrates fällt bei der Sitzung am Freitag, den 21.03.2025.
+++ Update 21.03.2025: Der Bundesrat hat den Punkt mit den Vorstößen zur Verschärfung des Waffengesetzes in Hinblick auf Schreckschusswaffen am Sitzungstag von der Tagesordnung für den 21.03.2025 genommen. Wir berichten an dieser Stelle, wenn mehr über die weiteren Pläne der Länderkammer bekannt ist. +++
Kommentar: Wie sinnvoll sind die Vorschläge im Bundesrat zur Begrenzung respektive zum Verbot von Schreckschusswaffen?
Um eines direkt vorweg zu nehmen: Beide Vorschläge sind unsinnig und kontraproduktiv. Dass beide vorliegenden Ideen offensichtlich mit wenig Expertise verfasst wurden, fällt jedem Waffengesetz-Praktiker (also mindestens allen Sportschützen und Jägern) sofort auf. Die plötzliche Einführung eines "Waffenscheins" als Erwerbsvoraussetzung passt nicht in die bisherige Terminologie des Waffengesetzes und erinnert eher an einen schlecht recherchierten Artikel der Tagespresse als an ein Machwerk von Innen- und Rechtsexperten. Das würde aber immerhin in den Trend der letzten Jahre passen. Schon lange scheut man sich nicht mehr, das Waffengesetz noch unverständlicher und unlogischer zu machen: Gegenstände ohne Waffeneigenschaft werden systemwidrig, irgendwo mitten im Gesetz reguliert (Messerführverbote). Oder die dritte Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme kommt ins Gesetz, anstatt einfach mal ein Verbot zu streichen (z.B. Nachtzieltechnik).
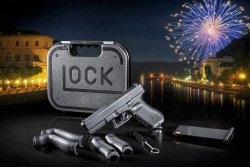
Abseits davon, ist auch schon der Vorschlag Hamburgs, inhaltlich wenig sinnvoll. Denn was bedeutet er konkret? Letztlich, dass Käufer von SRS-Waffen auf Eignung und Zuverlässigkeit überprüft sind. Der Preis dafür wird eine weitere Antragsflut bei den ohnehin schon bis zur Schmerzgrenze überlasteten Behörden sein. Für einen nicht bis kaum messbaren Einfluss auf Straftaten mit SRS-Waffen. Ein sinnvolles, bereits im Gesetz vorhandenes Instrument wird (wie bei vielen Verschärfungen zuvor) weiterhin ignoriert: Das individuelle Waffenverbot. Warum wird dieses Mittel nicht breiter genutzt? Das Zentrale Waffenregister würde einen einfachen "Check" durch den Händler vor Ort ermöglichen. Stattdessen setzt man auf weitere Regulierung und mehr Bürokratie.
Dem Innenausschuss des Bundesrates ist das aber scheinbar noch nicht genug. Denn – so ist es in der ebenfalls modifizierten Begründung zu lesen – reiche es nicht, den Missbrauch von Waffen in den Blick zu nehmen. Auch den gesetzestreuen, legalen Erwerbern und Besitzern der SRS-Waffen möchte man an den Kragen. Hier greift der Ausschuss dann auf seit spätestens den 1970ern Bewährtes zurück: Das gute, alte Bedürfnisprinzip. Das ist der ultimative Trick "waffenkritischer" Politiker. Erstens schränkt es die Zahl potenzieller Besitzer massiv ein, das ist hier nun auch das erklärte Ziel. Zweitens – das ist in dem Kontext vielleicht sogar wichtiger – nimmt man damit die breite Bevölkerung aus der Debatte und verlagert sie auf einige, wenige Menschen mit Partikularhobbies. Das erleichtert dann weitere Einschränkungen nach dem Salamiprinzip. Auch die hier formulierten Bedürfnisgründe irritieren: Wer beispielsweise keine Yacht oder keinen Weinberg sein Eigen nennt, dem kann scheinbar auch seine Schreckschusswaffe entschädigungslos abgenommen werden. Die anderen Gründe sind im Wesentlichen nicht überprüfbar. Wie weise ich der Behörde nach, dass ich Bergsteiger bin? Durch den Besitz von Seilen und Karabinern? Vereinszwang im Deutschen Alpenverein?
Noch absurder wird es dann nur bei der Folgenabschätzung des Ausschusses. Er rechnet selbst mit den Zahlen des VDB. Der geht von 37 Millionen SRS-Waffen bei 14 Millionen Besitzern aus. Die hauptsächliche Angst des Ausschusses: Dass einige Altbesitzer ohne Bedürfnis dennoch einen Antrag stellen und so Aufwand verursachen. Das ist sicher richtig. Wenn die überlasteten Behörden eines sicher nicht gebrauchen können, ist es, wichtige Zuverlässigkeitsüberprüfungen liegen lassen zu müssen, weil sie schauen sollen, ob der PTB-Waffenbesitzer auch tatsächlich eine Yacht hat. Was allerdings dem Ganzen die Krone aufsetzt: 14 Millionen Altbesitzer. Das ist statisch gesehen, jeder sechste Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. 16,66 Prozent der deutschen Bevölkerung werden dadurch kriminalisiert. Da hilft dann auch eine lange Übergangsregelung von vier Jahren nicht mehr. Es erübrigt sich zu dem Ansinnen auch jeder weitere Kommentar. Das darf so nicht Gesetz werden.